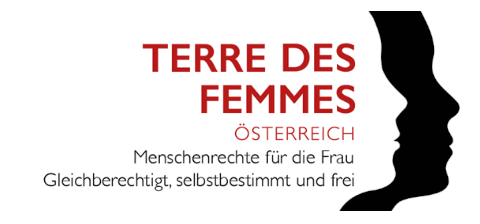Häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen

Im eigenen Heim leben Frauen am gefährlichsten. Weltweit ist das so, auch in Österreich. Frauen fürchten sich daheim. Sie fragen sich: Wann wird die nächste Attacke kommen? Hat sie was falsches gesagt? Was denken ihre Kinder über sie, wenn der Mann sie schlägt? Dass sie nichts wert ist? Dass sie alle in Lebensgefahr sind?
Häusliche Gewalt ist die häufigste Ursache von Verletzungen bei Frauen: häufiger als Verkehrsunfälle und Krebs zusammengenommen. Für Frauen ist das Risiko, durch einen Beziehungspartner Gewalt zu erfahren, weitaus höher als von einem Fremden tätlich angegriffen zu werden. Bildung, Einkommen, Alter und Religionszugehörigkeit sind dabei völlig bedeutungslos.
In Österreich ist oder war schon jede vierte Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Ihr eigenes Zuhause ist der gefährlichste Ort für eine Frau.
“Er hat gesagt, er hat nur zugeschlagen, weil ich zu laut war.”
Ulrike, 58 Jahre alt, Opfer von Gewalt und Mobbing**

**Ulrike wurde ein Jahr lang psychisch gequält und geschlagen. Letztendlich gelang es ihr, sich zu trennen und Schutz im Frauenhaus zu bekommen. Trotzdem kämpft sie vorerst mit einem inneren Drang, zu ihm zurückzukehren. Viele Frauen erleben ähnliches. Es ist schwer, aus diesem Unterdrückungssystem herauszukommen und sich wieder selbstwirksam und wertvoll zu fühlen.
Der Feind im Heim

Frauen sind in ihrem Zuhause aber nicht nur von häuslicher Gewalt betroffen, sondern häufig auch zusätzlich oder ausschließlich von sexualisierter Gewalt. Zwei Drittel aller Vergewaltigungen finden – entgegen der öffentlichen Wahrnehmung – zuhause, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz statt.
Nur wenige Täter üben sexualisierte Gewalt aufgrund einer psychischen Erkrankung aus. Die Meisten planen ihre Handlungen gezielt und sind sich darüber bewusst, was sie tun. Jede Frau und jedes Mädchen, gleichgültig wie alt oder attraktiv sie ist, welcher Nationalität oder Religion sie angehört, kann sexualisierte Gewalt erleiden. Diese Form der Menschenrechtsverletzung passiert in Österreich täglich: Jede siebte Frau musste in ihrem Leben schon einmal eine Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung erleben.
TDF Deutschland: Durch unsere Arbeit im Referat “Häusliche und sexualisierte Gewalt” machen wir die Öffentlichkeit auf diese drängenden Themen aufmerksam. Wir setzen uns für Gesetzesänderungen ein und vernetzen uns mit anderen Frauenorganisationen. Gemeinsam mit Unternehmen informieren wir Beschäftigte und sagen Nein zu häuslicher und sexualisierter Gewalt.
TERRE DES FEMMES FORDERT:
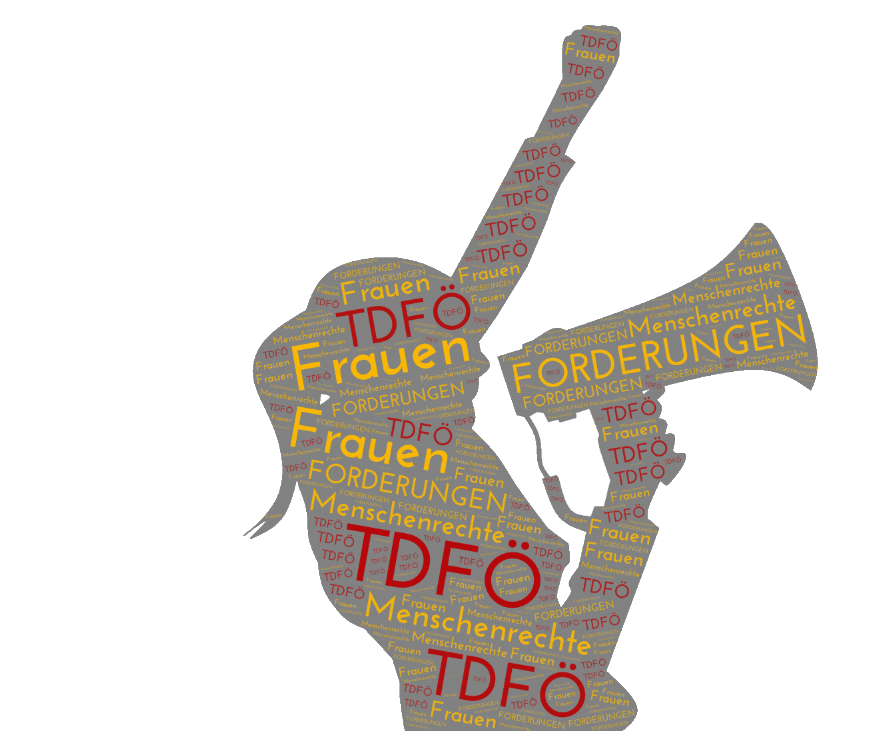
- Rechtsanspruch auf Hilfe bei Gewalt: Österreich muss sicherstellen, dass allen Frauen, die Gewalt erleiden, adäquate Hilfe und Unterstützung zur Verfügung steht, unabhängig von ihrem Wohnort, Gesundheitszustand, der Herkunft oder dem Aufenthaltstitel.
Das momentane Hilfesystem für Frauen nach Gewalt steht leider nicht allen Frauen zur Verfügung. Es ist weder flächendeckend ausgebaut noch ausreichend finanziert. Das Hilfesystem muss aber für alle gewaltbetroffenen Frauen und Kindern vorhanden sein. Betroffene haben ein menschenrechtliches Recht auf Hilfe und Unterstützung (s. Artikel 18, 23, 25 der Istanbul-Konvention). - Die Kritik am Gewaltsschutzgesetz muss aufgenommen werden und die Maßnahmen wie sie u.a. im Regierungsprogramm formuliert sind, ehestmöglich umgesetzt werden. Wir teilen die von Frauenorganisationen aufgestellte Forderung nach mehr finanziellen Mitteln zur präventiven und aktiven Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
- Datenerhebung: Daten zu Gewalt an Frauen müssen regelmäßig und umfangreich erhoben werden, auch unter Berücksichtigung der Folgen von Gewalt auf das weitere (Erwerbs-)Leben. In Österreich findet keine regelmäßige Datenerhebung zu Gewalt an Frauen statt und somit auch keine Überprüfung der bestehenden Hilfs- und Aufklärungsangebote. Daten zu Auswirkungen von Gewalt auf den Lebenslauf von Frauen, zum Beispiel auf ihre Erwerbsfähigkeit, fehlen. Die Istanbul-Konvention sieht jedoch die Erhebung von Daten bzw. konsistenten Zeitreihendaten dringend vor (s. Artikel 11). Formen, Verteilung und gesamtgesellschaftliche Kosten häuslicher Gewalt müssen genauer erforscht und bestehende Gegenmaßnahmen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden.

- Aussetzung des Umgangsrechts für das gewalttätige Elternteil: Bei Verdacht auf Gewalt darf es – nur unter Umständen – einen begleiteten Umgang geben. Im Vorfeld muss eine Gefahrenanalyse stattgefunden haben. Das Umgangsrechtsverfahren darf bei Verdacht auf häuslicher Gewalt nicht beschleunigt werden.
Gerade in hochbrisanten Fällen von häuslicher Gewalt kommt es immer wieder bei Übergabesituationen zu einer erneuten Gefährdung der Frau. Das muss verhindert werden und zugleich muss das Kindeswohl stärker in den Vordergrund rücken. Gewalt zwischen den Eltern ist für Kinder eine schwere psychische Belastung.
Einem Kind, das jahrelang mit ansehen musste, wie der eigene Vater die Mutter misshandelte, kann nicht zugemutet werden, Kontakt zum Vater pflegen zu müssen. Es sollte unabhängig von seinem Alter selbst mitbestimmen dürfen, was seinem Wohl dient. Das Kindeswohl und die Sicherheit der Betroffenen müssen immer Vorrang haben. Zudem darf das Umgangsrechtsverfahren bei Verdacht auf häusliche Gewalt nicht beschleunigt werden.